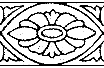9. Die Furcht und der Schmerz des Leidens als Einwand gegen die Gleichheit des Sohnes.
S. 165 Sehr viele von ihnen wollen nämlich wegen seiner Furcht vor dem Leiden und wegen der Schwachheit des Erleidens, er sei nicht im Besitz des Wesens eines leidensunfähigen Gottes gewesen; so daß also, wer Furcht gehabt und gelitten hat, entweder nicht jene Sicherheit der Macht gehabt habe, die keine Furcht kennt, oder nicht jene Unverletzlichkeit des Geistes, für die der Schmerz fremd ist. Er besitze vielmehr gegen Gott-Vater ein unterlegenes Wesen und habe in der Furcht menschlichen Leidens gezittert und bei der Furchtbarkeit der körperlichen Strafe aufgeseufzt. Von dieser Behauptung ihres Falschglaubens lassen sie nicht ab, weil geschrieben steht: „Traurig ist meine Seele bis zum Tode”1 und wiederum: „Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber”,2 aber auch dies: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?”3 Dem fügen sie auch hinzu: „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist!”4
Alle diese Bekundungen unseres rechten Glaubens machen sie sich gewaltsam zum Mißbrauch ihres Falschglaubens zunutze; daß nämlich in Furcht gewesen sei, wer traurig ist, wer auch um das Vorübertragen des Kelches gebetet hat; daß Schmerz gelitten habe, wer in seinem Leiden über die Gottverlassenheit geklagt; daß auch schwach gewesen sei, wer seinen Geist dem Vater anbefohlen habe; und die Bedrängnis lasse nicht die Ähnlichkeit eines in der Geburt des Eingeborenen mit Gott gleichgestellten Wesens zu, das seine Schwachheit und Verschiedenheit durch die Kelchesbitte und durch die Verlassenheitsklage und durch die Anbefehlungsworte bezeuge.