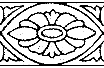Nachwort Trost der Philosophie
S. 192 Das „persönlichste Werk des Altertums“ nennt der Übersetzer die fünf Bücher vom Trost der Philosophie, und persönlich dürfen wir sie wohl im doppelten Sinne heißen. Boethius erzählt in den beiden ersten Büchern sein Leben selbst. Nur wenig Daten und Tatsachen haben die zeitgenössischen Quellen wie die neuere Forschung darüber hinaus noch erschließen können. Mehr aber darf es persönlich genannt werden, weil ein dunkel gewaltiges Schicksal des Verfassers hinter diesem Werke steht, ihm gleichsam den Griffel führt, es durchglüht und durchleuchtet. Dieses aber, so erschütternd es auch als solches ist, ergreift uns nicht nur als das eines einzelnen, sondern es wird zu einem tiefen Symbol des Schicksals des römischen Reiches überhaupt. Mit Boethius geht die alte Welt zu Ende, hier noch einmal verdichtet sie in einer Gestalt Geist und Gesinnung des echtesten, edelsten Römertums, um noch im Unterliegen einen hohen Triumph zu feiern. „Es ist die Apologie des Altertums und seiner Weltanschauung, daß es so stolz und hoffnungsfreudig untergehen konnte“ (Gothein). Hier liegt auch das tiefste Geheimnis der Wirkung, die dies Werk auf das ganze Mittelalter hat ausüben dürfen. Sein Gedankeninhalt führt uns zu einer Zeitenwende; Boethius hat in sein Werk wie in ein Sammelbecken die reichsten und reinsten Quellen einer fast tausendjährigen Philosophie geleitet, und von hier aus hat sich ein weiteres Jahrtausend daran erquicken, erbauen, stärken und belehren dürfen. Daß aber hier ein Philosoph wenn je einer seine Philosophie gelebt und mit seinem Blute besiegelt hat, mußte sie so unwiderstehlich für ein Zeitalter machen, das seiner ganzen Weltanschauung nach solchen „Zeugen“ tiefste Verehrung brachte, mußte es auch über dunkelste Zeiten hinaus lebendig erhalten. In diesem Sinne hat unser Werk gewiß wenig Mitbewerber in der ganzen Weltliteratur. Wenn Wilhelm v. Humboldt die Baghavatgita das größte philosophische Gedicht nennt, so hat er gewiß Recht, was die Größe und Tiefe des Mythos betrifft, der dahinter steht. Die Consolatio aber darf dem indischen Gedicht wohl an die Seite treten in dem hohen Flug abendländischer Gedanken. Der rigorosen Reinheit seiner ethischen Forderungen hat der Osten nichts entgegenzusetzen. Die allegorische Einkleidung, die es dem Mittelalter so besonders empfiehlt, wird von dem lebendigen Blut eines tragischen persönlichen Schicksals gespeist, wie es wieder der Orient niemals hätte erfassen können.
S. 193 Anicius Manlius Severinus Boethius, wie sein voller Name lautet, stammte aus dem weit verbreiteten Geschlecht der Anicier, das sich zu den vornehmsten des römischen Stadtadels zählen durfte. Drei Generationen der Boethius treten in der Geschichte hervor. Der Großvater war jener Boethius, der an der Seite seines Freundes Aetius fiel, den Kaiser Valentinian III. in Rom eigenhändig ermordete, weil er ihm zu mächtig war; Boethius war damals, i. J. 454, praefectus praetorio. Sein Name vererbt sich auf seinen Sohn Flavius Manlius Boethius, von dem wir nur wissen, daß er unter Odovacar eine Reihe von Ehrenämtern bekleidet hat; er war zweimal praefectus urbi, einmal praefectus praetorio und im Jahre 487 Consul. Der berühmte Sohn ist damals etwa 5 bis 7 Jahre alt gewesen; sein Geburtsjahr schwankt zwischen 480 und 482. Sehr bald darauf aber muß der Vater gestorben sein, Boethius klagt und rühmt (Cons. 40, 13), daß er „eine vaterlose Waise, von der Sorgfalt hervorragendster Männer erzogen“ sei. Daß einer von diesen Männern Symmachus, sein späterer Schwiegervater war, erfahren wir an gleicher Stelle. Mit tiefer Verehrung und Dankbarkeit vergalt Boethius immer aufs neue die frühe Liebe dieses edlen Mannes. Er nennt ihn „verehrungswürdig, wie du selbst (die Philosophie, Cons. 20,118), eine köstliche Zierde des Menschengeschlechts“ (Cons. 44,12), er gebraucht für Symmachus das gleiche Wort „sanctus“, mit dem einst Dante ihn selbst schmücken sollte, als er in der Sonnenrose unter den zwölf Weisen auch ihn, die „anima santa“, erblickt.1 Symmachus war der Urenkel des berühmten Redners und Staatsmannes, der ein Jahrhundert früher unter Kaiser Gratianus und Theodosius den immer wieder erneuten Versuch machte, die heidnische Religion in Rom zu schützen, das alte Wahrzeichen inmitten der Curie, den Altar der Victoria, an dem den Kaisern gehuldigt und geopfert wurde, den Gratianus entfernt hatte, wieder zurückzubringen. Aber obgleich er bis in sein Alter auch bei den Kaisern hoch geehrt war, mußte er doch seinem mächtigen Gegner Ambrosius, dem Bischof von Mailand, unterliegen, so sehr auch dieser den „letzten Heiden“ gut behandelte, er mußte noch bei seinen Lebzeiten sehen, wie die christliche Partei auch im Senat immer größer wurde.
Von seinem Urenkel, Q. Aurelius Symmachus, wird gerühmt, „seine Frömmigkeit habe seine Tugend, nach Weise der Altvorderen, die sich den alten Cato (gemeint der Uticensis) zum Vorbild genommen habe, noch erhöht“.2 Boethius hat ihm zwei Schriften gewidmet, eine frühe theologische „De Trinitate“ und seine zwei Bücher „De institutione arithmetica“. In beiden Widmungen spricht wiederum die tiefe Verehrung: nur Vollendetes wolle er dem weisen Kenner beider Sprachen vorlegen. S. 194 Nur an seinem Urteil ihm könne gelegen sein, „denn wohin sonst meine Augen fallen, begegnen sie nur träger Gedankenfaulheit oder verschlagenem Neid“. Zwei Jahre vor des Boethius Vater wurde Symmachus Consul i. J. 485. Wie nahe sich die beiden Männer persönlich standen, zeigt die Liebe, die Symmachus auf den Sohn des Freundes übertrug. Wohl schon vor seinem Consulat war er praefectus urbi. Aus Cassiodors Briefen3 erfahren wir, wie er sein großes Vermögen anwandte zur Verschönerung der Stadt und Erhaltung der alten Gebäude. Auch für das Wohl der i. J. 425 von Valentinian gegründeten Universität sorgte er; Jünglinge, die dort studierten, wurden seiner Obhut empfohlen. In dem Schisma der beiden römischen Gegenpäpste, dem die Kirchenspaltung zwischen Rom und Byzanz vorausgegangen war, stand Symmachus auf der Seite des orthodox italisch gesinnten Papstes Symmachus. Doch hat er an den fanatisch wilden Kämpfen, die Rom damals während der ganzen Knaben- und Jünglingszeit des Boethius beunruhigten, wohl nicht sehr aktiv teilgenommen, denn in den schlimmsten Zeiten mußte der gallische Bischof Avitus4 ihn, wie Faustus, das Haupt der italischen Partei im Senat, mahnen, den Papst tatkräftiger zu unterstützen und nicht nur an das Wohl des Staates zu denken.
Unter solcher Obhut wuchs der junge Boethius auf. Durch seine Abstammung, seinen großen Reichtum, seine Freundschaft und Erziehung, war er mitten hineingestellt in eine Lebensanschauung, die noch von einem späten Glanze alter Kultur durchleuchtet war. Noch war der Senat, dem diese vornehmen Familien angehörten und die vielfach Verwandtschaft und nahe Freundschaft verband, eine Körperschaft, die auf Geltung Anspruch machte, wenn man auch wußte und spürte, wie die Macht längst ihren Händen entrissen war. Boethius' Schicksal, der sich immer mit Betonung als Vertreter des Senates fühlte, wird dies am allerdeutlichsten zeigen. Die Knabenjahre, die er in diesem „Hause unschuldiger Heiligkeit“ zubrachte, waren ganz „den Studien Eleas und der Akademie“ gewidmet. Die Früchte dieser Erziehung zeigten sich bald. Der Ruf seiner großen Gelehrsamkeit verbreitete sich, als er kaum die Schwelle des Jünghngsalters überschritten hatte. Ennodius5 rühmt von ihm: „Schon im Knabenalter war unverwandtes Studieren seine Lust und sein Ruhm ... und in den Jahren des Lernens hatte er schon die Erfahrung des Lehrens gesammelt.“ Wenn wir die überkommenen Schriften des Boethius überschauen, so fällt neben dem Fragmentarischen, d. h. daß ihn das Schicksal verhinderte, alles auszuführen, was er sich vorgesetzt hatte, eine gewisse Methodik seiner Arbeitsweise auf. Seine Absicht war, wie er selbst S. 195 sagt,6 „das ganze Werk des Aristoteles zu übersetzen und mit einem lateinischen Kommentar zu versehen, ebenso auch alle Platonischen Dialoge zu übersetzen und zu kommentieren.[„] Ehe er sich aber, etwa um das Jahr 507/508, zuerst die logischen Schriften des Aristoteles zu bearbeiten vornahm, hat er in seinen Jugendjahren sich mit den Disziplinen beschäftigt, die er selbst mit dem von ihm zuerst gebrauchten Ausdruck Quadrivium benennt, die er als Vorstufen zur höheren Philosophie ansah: Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie, und sehr wahrscheinüch hat er zu jeder dieser Disziplinen eine Schrift verfaßt, wenn auch nur „de institutione arithmetica“ und die fünf Bücher über die Musik sich erhalten haben, die beide auf Nikomachus von Gerasa fußen. Von dieser frühen Schriftstellerei insbesonders hören wir aus drei Briefen, die Cassiodor, der Geheimschreiber des Königs Theoderich, in dessen Auftrag an ihn richtete. Die Anlässe zu diesen drei Briefen wären an sich geringfügig, zeigten sie nicht einmal, daß der König großes Vertrauen in den römischen Patricier setzte, so in dem Briefe (Cass. Var. I. 10), in dem er ihn bittet, gewisse Klagen der Palastbeamten über unrichtiges Maß und Münzgewicht bei Auszahlung ihres Gehaltes zu untersuchen und die Ungerechtigkeit abzustellen. Boethius wird in diesem Briefe Patricius angeredet, ein Ehrentitel, der, durch Kaiser Constantin eingeführt, nur nach Bekleidung eines zur ersten Rangklasse gehörenden Staatsamtes verliehen werden konnte.7 Wir wissen durch Boethius selbst, daß er „Würden, Greisen versagt, in der Jugend erhielt“ (Cons. p. 40, 19), doch fehlt jeder weitere Anhalt, welches diese Würden waren. Wichtiger ist, was wir über die Werke erfahren. Der Geheimschreiber des Königs machte gerne aus den königlichen Aufträgen kleine, stilistisch oft überfeinerte, gelehrte Abhandlungen und besonders, wenn es wie hier galt, seinem gelehrten Altersgenossen zu zeigen, daß auch er in den Wissenschaften, die jener behandelte, zu Hause war. Der König der Franken, Chlodovech, hatte seinen Schwager Theoderich gebeten, ihm einen Kitharöden zu senden, da er sich bei den Gastmählern am Hofe von Ravenna an der Musik des Sängers des Königs so erfreut habe; der König Theoderich, der auch seine persönliche Umgebung und sein intimes Leben gern nach altrömischer Sitte gestaltete, hatte auch diese „zum Ruhme seiner Feste“ gepflegt. „Diese Bitte“, schreibt Cassiodor (Var. II, 40), „haben wir nun zu erfüllen versprochen, weil wir wußten, daß du zur Wissenschaft der Musik gelangt bist. Es liegt ja nahe, einen von dir ausgebildeten Kitharöden zu wählen, der du diese Wissenschaft in ihrer Schwierigkeit geordnet und untersucht hast“.8 Die fünf Bücher über die Musik, deren Inhalt Cassiodor hier ausführlich behandelt, sind wohl die zweite Schrift des jungen Boethius; sie S. 196 sollte von weittragender Bedeutung „für die Musikanschauung des Mittelalters werden als unverrückbare Wissensnorm und unerschöpfliche Wissensquelle, bald aber auch als das Werk eines [„]Göttlichen, der die Musik erfunden“.9 Ja, in dem klassischen Lande der Tradition, in England, war es noch „bis in neuere Zeit in Oxford und Cambridge im Gebrauch“.10 Einem ähnlichen Anlaß galt der dritte Brief (Var. I, 45), etwa um 506 geschrieben.11 Hier hatte der Burgunderkönig Gundabad Theoderich gebeten, ihm eine Sonnen- und Wasseruhr, ein damals viel bestauntes Wunder der Technik, und zugleich sachverständige Meister zu senden; und wieder wendet der König sich an Boethius, an den in den mathematischen Wissenschaften Bewanderten, „der du gemästet (saginatum) mit Gelehrsamkeit bist ... die Gelehrtenschulen der Athener als einer, der dort lange feststeht, betreten hast ... so werden als Lateiner in deinen Übersetzungen gelesen: der Musiker Pythagoras, der Astronom Ptolemäus; der Arithmetiker Nicomachus, der Geometer Euclid werden von den Ausoniern vernommen; Plato, der Theologe, und Aristoteles, der Logiker, disputieren mit Quirinischen Worten; ebenso hast du die Mechanik des Archimedes den Siculern lateinisch wiedergegeben. Was auch immer von Wissenschaften und Künsten die griechische Redegewandtheit durch vorzügliche Männer hervorgebracht hat, ist durch dich, den einen Autor, in lateinischer vaterländischer Rede ausgeführt worden.“ Die Datierung der Briefe ist zu ungelöst, ihr Stil zu höfisch, als daß man alle diese Werke daraus bestimmen könnte, doch bleiben sie ein Zeichen der großen Vielseitigkeit des Boethius. Und aufschlußreich sind sie dafür, wie nahe sich in jener Zeitauffassung Wissenschaft und praktisches Leben, dort Musik, hier Technik, standen.
Ein sicheres Datum für die Schriften ist nur sein Consulatsjahr 510, wo Boethius die Kategorien des Aristoteles übersetzte. Den logischen Schriften des Meisters gehört fortan der größte Teil seiner Zeit. „Das war die große entsagende Rettungsarbeit, die Boethius an der antiken Philosophie und exakten Wissenschaft vollzieht, wodurch er zum Lehrer und Vermittler des Mittelalters wird“ (Gothein). Allerlei Vorarbeiten und selbständige Schriften begleiten diese Hauptarbeit, zu den ersteren gehört vor allem eine Übersetzung und ein doppelter Kommentar zu der Isagoge des Pophyrius, ein Schriftchen, das sich Einführung zu den Kategorien des Aristoteles nennt und in dieser Fassung des Boethius das ganze Mittelalter beherrscht hat. Später führte ihn dann auch ein Kommentar zu Ciceros Topik diesem Philosophen nahe. Cassiodor nennt in dem erwähnten Briefe auch Plato unter den von Boethius übersetzten Autoren, daß dies in seiner Absicht lag, S. 197 sahen wir. Erhalten, wenn er etwas ausgeführt hat, ist nichts. Von einem letzten Ziel, das ihm vorschwebte, spricht er in der Einleitung zu den Kategorien:12 „Ich will des Aristoteles und des Plato Lehrmeinungen (sententias) gewissermaßen als Einheit herausarbeiten und sie nicht, wie es meistens geschieht, in allem abweichen lassen, sondern ich will zeigen, wie sie im meisten und innersten in ihrer Philosophie übereinstimmen.“ Auch diese Frage zu behandeln war ein Zeitgut, besonders die Neuplatoniker haben sich häufig daran versucht. Zu einer wissenschaftlichen Schrift, in der Boethius diese Gedanken hätte ausarbeiten können, ist er nicht mehr gekommen, aber wir werden noch sehen, wie sie in seinem letzten Werke, in dem Trost der Philosophie, ihm stetig vor Augen standen. Etwa auf zwanzig Jahre hat sich dieses erstaunlich reiche Lebenswerk, wenn wir nur das, was erhalten ist, überschauen, verteilt. Zu den etwa 21 philosophischen Schriften kommen dann noch drei theologische Traktate. Die Streitfrage, ob Boethius der Verfasser dieser Schriften war, ist längst zu seinen Gunsten erledigt. Daß man ihm sogar sein Christentum hat absprechen wollen, konnte nur „eine auf geschichtlicher Unkenntnis beruhende Meinung sein ... es versteht sich, daß Boethius, auch wenn er nicht Symmachus Schwiegersohn gewesen wäre, nicht offener und nicht einmal verkappter Heide sein konnte“. 13 Seine theologischen Schriften, die zum Erstaunen Neuerer nicht ein einziges Bibelzitat enthalten, lösen christliche Dogmen vom rein philosophischen Standpunkte. Boethius war Philosoph, aber man darf nicht vergessen, daß auch innerhalb der Kirche die philosophischen Interessen damals vorherrschten, so daß der Streit um den Monophysitismus die Grundfesten der Kirche zu erschüttern drohte. In Stil und logischer Beweisführung zeigen diese Schriften, besonders die erste, De Trinitate, manche Berührung mit der letzten, der Consolatio Philosophiae, die allerdings vom christlichen Dogma gar nichts weiß, aber es ist ja auch die Philosophie und nicht die Theologie, die zu ihm als Trösterin tritt.
Alle äußeren Bedingungen für ein den Studien gewidmetes Leben waren Boethius gegeben. Wohl wenige Jahre vor seinem Consulat wird er die Ehe mit Rusticiana, der ältesten Tochter des Symmachus, geschlossen haben. Rusticiana war nach ihrer Ältermutter, der Gattin des berühmten Redners, genannt, von Boethius wird sie „bescheiden, schamhaft, von keuschem Wesen und, um alle ihre Gaben kurz zusammen zu fassen, dem Vater gleich“ gepriesen (Cons. 44,15/16). Ein Jahrzehnt und länger reichsten Glücks durfte er nun verleben, in wissenschaftlich philosophische Studien versenkt in einer Umgebung, die er sich mit großem Reichtum verschönte; die Wände seiner Bibliothek, wo er unter Leitung der Philosophie in die Geheimnisse der S. 198 Natur eindringen und sein Leben nach der himmlischen Ordnung einrichten konnte, waren mit Kristall und Elfenbein ausgelegt (Cons. 26, 17). Aber doch nicht nur als Gelehrter hat Boethius diese Jahre hingebracht. Von Anbeginn hat er seine ganze schriftstellerische Tätigkeit pädagogisch aufgefaßt. Als er während seines Consulatsjahres vielfach durch Geschäfte von seiner Arbeit abgelenkt wird, entschuldigt er sich: wenn er auch nicht alle Sorgfalt und Muße auf diese Studien habe verwenden können, „so scheinen sie sich dennoch irgendwie auf die Sorge um den Staat zu erstrecken, indem durch die Lehre einer so durchstudierten Sache die Bürger unterrichtet werden“, und etwas weiter heißt es, er habe durch das, „was von den griechischen Weisen übriggeblieben sei, die Sitten unseres Staates unterwiesen“.14 Im Trost der Philosophie aber beruft er sich auf das Platowort, daß die Staaten glücklich seien, die von Philosophen regiert würden; „so bin ich deinem (der Philosophie) Befehl gefolgt, und was ich in geheimer Muße gelernt hatte, habe ich in öffentlichem Staatsdienste angewandt“ (Cons. 14,13 ff). Unter diesem Gesichtspunkte muß die staatliche Tätigkeit des Boethius allein angesehen werden. Er war auch hier nur Philosoph und Lehrer, rein ethische Gesichtspunkte haben ihn in der Verwaltung seiner Ämter geleitet.
So mußte in der Ausübung der öffentlichen Ämter seine unbestechliche Redlichkeit und die Strenge seiner sittlichen Forderungen ihn in Konflikt bringen mit Habgier und Unterdrückung von Seiten gotischer wie römischer Höflinge und Machthaber, und mit Recht sieht Boethius schon in seiner ganzen öffentlichen Tätigkeit, seinem steten Eintreten für die Unterdrückten und Schwachen den Keim zu seinem Verderben (Cons. 16, 41). Noch aber lebte er hochangesehen unter den Standesgenossen, in voller Fürstengunst, und als „einziger Gipfel seines Glückes“(Cons. 40,19/20) sollte ihm noch eine besondere Ehre bevorstehen. Zwei Söhne, Symmachus und Boethius benannt, waren dieser glücklichen Ehe entsprossen, in deren „Geist sowohl die väterliche wie die großväterliche Art durchleuchtet“ (Cons. 44, 19 ff.). Noch im Knabenalter wurden sie im Jahre 522 von König Theoderich zu Consuln ernannt. Eine solche Ehrung war in jener Zeit nicht einzigartig, aber doch selten.15 Freilich war wohl keines der alten römischen Ämter so sehr von seiner einstigen Höhe herabgesunken wie der Consulat. Längst war er, und erst recht zu des Boethius Zeiten nichts weiter als ein mit kostspieligen Pflichten für Volksspiele und Spenden verbundenes leeres Ehrenamt, wahrscheinlich wurden die Kandidaten vorher um ihre Einwilligung gefragt, rechnete man doch zu Zeiten des Justinian die Ausgaben für Spiele auf 20 Zentner Gold. Doch immer noch war der Consulat ein Vorrecht der Vornehmsten, und noch wurde das Jahr nach den Consuln genannt, woran S. 199 auch Theoderich nicht rüttelte, was am besten zeigt, wie sehr er sich als den Fortsetzer römischer Tradition, ja als römischen Beamten fühlte, während bei den andern germanischen Staaten, auch den Westgoten, während sie unter seiner Herrschaft waren, nach dem Herrscherhause genannt und gerechnet wurde. Aber gerade noch zu Boethius Zeit hielt man an diesem letzten Schein der Macht fest; Kaiser Justinian schaffte dann auch dies Vorrecht ab, als er bestimmte, daß der Consulat nur noch den Herrschern zukomme. Der letzte weströmische Consul wurde i. J. 534 ernannt, der letzte oströmische i. J. 541.
Doch zu des Boethius Zeit wurde die Ernennung mit immer größerem Prunk gefeiert, und auch er berauscht sich noch im Gefängnis an der Erinnerung jenes Tages, „als du deine beiden Söhne zugleich als Consuln aus deinem Hause von den versammelten Vätern unter dem Jauchzen des Volkes fortgeführt sahst, und nachdem sie auf ihren curulischen Sesseln saßen, du dir als Lobredner des Königs den Ruhm der Beredsamkeit verdientest, als du dann im Zirkus inmitten der beiden Consuln die Erwartung der umherwogenden Menge mit Ehrenspenden befriedigtest“ (Cons. 40,22 ff). Die hohe Ehre der Ernennung war deshalb so bedeutsam, weil beide Consuln römischer Abstammung waren; selbstverständlich waren sie von Theoderich ernannt, wie die Lobrede auf den König beweist, doch konnte er es nur mit Einwilligung des Kaisers tun, der ein Recht auf die Ernennung eines Ostkonsuls hatte. 16 So beweist die Ernennung eines mit Sicherheit, daß das Jahr 522 unter den Auspizien einer freundlichen Beziehung zwischen Theoderich und dem Kaiser Justinus begann und daß dieser auch mit der besonderen Ehrung eines Senatsmitglieds einverstanden war. Das Jahr aber sollte nicht zu Ende gehen, ohne daß der König dem Boethius ein neues Zeichen seiner Gunst verlieh, indem er ihn, wahrscheinlich im September 522, bald nach der öffentlichen Lobrede auf den König zum magister officiorum ernannte. Wie nun innerhalb eines Jahres der Sturz von dem Gipfel der Königsgunst zu Kerker und Tod kommen konnte, wird sich einwandfrei wohl niemals erklären lassen, da authentische Akten verloren sind. Wir haben aber kein Recht, die Darstellung des Boethius und die wenigen zeitgenössischen Quellen, den Gotenkrieg des Procop und den Anonymus Valesianus, anzuzweifeln, bloß um die Höflingspartei der Ankläger zu entlasten. Daß sie am Hofe in Ehren blieben und aufstiegen, versteht sich aus ihrem Sieg. Und die Elogien, die Cassiodor im Auftrag des jeweiligen Herrschers an sie, besonders an den Hauptankläger Cyprian richtete, können gewiß nicht für ihren Charakter in diesem S. 200 Prozeß herangezogen werden. Des Königs Unrecht aber beklagen beide Quellen.
Boethius hat als Knabe noch den Sieg des Theoderich über Odovacar erlebt; er war ein Jüngling, als der König i. J. 500 zum ersten Male in Rom einzog, um dort seine Tricennalien, das dreißigste Regierungsjahr als gotischer König, zu feiern. Man meint sogar, Boethius habe ihm damals eine Lobrede gehalten, was aber nicht sicher bezeugt ist.17 Theoderich hat mit klugem Takt und weit ausschauendem Auge nicht nur an keines der Vorrechte des Senats und des Volkes gerührt, sie alle auf das heiligste beschworen und diesen Schwur auch gehalten, sondern er hat bei seiner Besitznahme von Italien überall äußerste Milde walten lassen, hat die Beamten des Odovacar in verantwortlichen Stellen gelassen oder eingesetzt, hat in Rom sofort nachgegeben, als Symmachus für die von Odovacar dem Senat neu zugewählten Mitglieder (pro allecticis) sprach, die der König anfangs entfernen wollte. Nach Mommsen 18 fand Theoderich die Reichsgestaltung in Italien schon als eine Schöpfung des Odovacar vor und ist hier nur in seine Fußtapfen getreten. Eine neue Aufgabe aber für den König waren die kirchlichen Zustände. Er kam mitten hinein in die wilde religiöse Erregung des Schismas, ihm sollte es auch hier gelingen, allmählich Ruhe herzustellen. Es kam ihm dabei vielleicht zugute, daß er als Arianer unparteiisch sein konnte, „dem Arianer, der Ordnung schaffte und der katholischen Kirche Schutz zusicherte, reichte der Römer freudig die Hand, die er von dem schismatischen Byzanz zurückzog“.19 Jahrzehntelang hat es diese weise Politik des Herrschers verstanden, Italien den Frieden zu erhalten durch strenge Scheidung gotischer und römischer Gerechtsame; kein Gote konnte ein römisches Staatsamt verwalten, kein Römer einen militärischen Posten bekleiden, was doch unter Odovacar noch möglich war. Dadurch brachte es der König auch fertig, daß man selten von inneren Unruhen zwischen Römern und dem zwangsangesiedelten Gotenvolke hört. Um das Jahr 523 aber muß in der Gesinnung des Königs gegen die Römer und besonders den Senat ein Umschwung eingetreten sein. Boethius spricht in seiner Darstellung vom König nur einmal, daß er rachsüchtig den Untergang des ganzen Senats erstrebt habe (Cons. 20, 90). Eine ausführliche Verteidigungsschrift, die er im Gefängnis verfaßt hat, „damit die Wahrheit der Nachwelt ausführlich bekanntwerde“ (Cons. 18,68/69), hat sich leider nicht erhalten. Das Verhängnis begann, als der Referendar des Königs Cyprianus gegen den Senator und früheren Consul Albinus eine Anklage wegen hochverräterischer Verhandlungen mit Byzanz erhob. Die Referendare hatten S. 201 am Hof die Aufgabe, dem König Vorträge über Staatsangelegenheiten zu halten, ein wohl nicht immer ganz leichtes Geschäft bei dem heftigen Wesen des Königs. Cassiodor (Var. V, 41) gibt uns ein farbiges Bild, wie der alte Kriegsmann, ermüdet von den Vorträgen im Palast, einen Spazierritt unternommen habe, um seinen Geist zu erfrischen, Cyprian mußte ihn dabei begleiten und bei der dem König gewohnten Bewegung Vortrag halten. Sein unerschrockenes Verhalten gegenüber dem König wird besonders gelobt, „wo er häufig den Ungestüm unseres Geistes ausgehalten hat“. Der König hatte gewiß Freude an dem schneidigen Auftreten des jungen Beamten; das erklärt in etwa, daß Cyprian in so ungewöhnlichem Maße das Ohr des Königs besaß, wie der ganze Prozeß des Boethius zeigt, „wo er so ganz gegen seine Gewohnheit ohne sorgfältige Untersuchung das Urteil sprach“.20 Aber der König mußte doch schon irgendwie gegen den Senat eingenommen sein, daß er sich Cyprian so leicht fügte.
Man hat mit Recht darauf hingewiesen, daß seit dem Regierungsantritt des Kaisers Justin i. J. 519, nachdem seine Bestrebungen einer Versöhnung der östlichen und der westlichen Kirche erfolgreich waren, sich nicht nur der römische Klerus, sondern auch der römische Senat Byzanz wieder stärker zugewendet hatte. Man hatte wohl nie in Rom den Gedanken einer Zusammengehörigkeit der beiden Reichshälften aufgegeben; doch hätte dies ja niemals ein Majestätsverbrechen sein können, da auch Theoderich diese Zugehörigkeit selbst immer betont hat; so sehr er de facto eine fast absolutistische Macht in Italien ausgeübt hat, betrachtete er sich doch in erster Linie als römischen Beamten des Kaisers. Er hat „während seines gesamten Regiments wohl der Sache aber nie der Form nach sich selbständig gestellt“.21 Es war das Bewunderungswürdige seiner Politik, daß er das Staatsschiff zwischen diesen beiden Extremen immer gut durchgesteuert hat. Dies konnte er aber nur, wenn er sich auf Senat und Kirche in Rom sicher verlassen konnte; sollte dies nun irgendwie durch die Politik des Kaisers gestört werden? Zudem muß ihm wohl um diese Zeit die Kunde von den Verfolgungen der Arianer in Byzanz zugegangen sein; denn der Kaiser war nicht nur ein guter Katholik, sondern ein Ketzerhasser. Dies mußte den König um so mehr empören, als er die katholische Kirche in Italien immer geschützt hatte und aller Proselytenmacherei abhold gewesen war. Vielfache Verluste in der Familie hatten außerdem den altgewordenen König verdüstert. Durch den Tod seines Schwiegersohnes Eutharich, der wohl schon i. J. 522 plötzlich verschied,22 war die Thronfolge wieder unsicher geworden. Der König bestimmte zwar noch selbst seine Tochter Amalasuntha und deren kleinen Sohn als S. 202 Nachfolger, aber er mochte wohl ahnen, daß eine Frau und ein unmündiges Kind sein Werk schwer würden fortsetzen können. Machte ihn auch dies so mißtrauisch? So sehr das wüste Bild, das der Anonymus von seinen letzten Jahren entwirft, übertrieben sein mag,23 es zeigt deutlich seine Verdüsterung. In diese Stimmung des Königs hinein kommt nun die Anklage des Cyprian, so mußte es für diesen ein leichtes sein, eine unvorsichtige Äußerung eines Senators ihm für seine Herrschaft bedrohlich und zugleich als ein Zeichen von dem Verhalten des ganzen Senates darzustellen. Der König residierte, als die Anklage erfolgte, in Verona, eine von den drei Städten Oberitaliens, in denen er sich einen Palast erbaut hatte. Als magister officiorum hielt sich natürlich auch Boethius dort auf. Er unternahm es, vor dem König Albinus zu verteidigen und sich zugleich der Sache des Senats anzunehmen. Der Anonymus überliefert uns die Worte des Boethius: „Falsch ist die Beschuldigung des Cyprian; wenn Albinus etwas getan hat, so bin ich, ist der ganze Senat seine Mitschuldigen; es ist nicht wahr, o König“.24 Ein unvorsichtiges Wort, aber Boethius war kein Höfling, seine Erziehung im Hause des Symmachus, wo christliche Ethik und antike Tugend verbunden herrschten, sein eigenes immer tiefer eindringendes Studium in die antiken Philosophen hatten ihm „als schönsten Ertrag Adel und Unabhängigkeit der Gesinnung“25 eingetragen. So hatte, wie wir sahen, seine sittliche Strenge ihm schon vorher manchen zum Feinde gemacht. Boethius war als magister officiorum Vorgesetzter des Referendarius Cyprianus; sich gerade durch diesen gehemmt zu sehen, mußte Zorn und Eifersucht des temperamentvollen Mannes erregen. Cyprian fühlte sich als ein Haupt der Hofpartei, die von Boethius in seiner Stellung als Römer und Vertreter des Senates und der senatorischen Rechte schon an sich verachtet wurde. So reifte denn in Cyprian „nach kurzem Zögern“ der Entschluß, auch Boethius zu verderben. Nicht er selbst strengte den neuen Prozeß an, konnte es wohl auch nicht tun, er suchte sich Helfershelfer in seiner nächsten Verwandtschaft: seinen Bruder Opilio (wohl kaum der Consul des Jahres 524, da bei dessen Amtsantritt der Prozeß noch im vollen Gange war), dessen Schwager Basilius und einen nicht weiter bekannten Gaudentius. Basilius, schon früher durch eine Ehegeschichte übel beleumundet, Opilio und Gaudentius, durch bedrohliche Schulden belastet, fanden sich bereit die Klage einzureichen, die vom König angenommen wurde. Sie lautet auf drei verbrecherische Handlungen. Einmal habe Boethius die Rettung des Senats gewollt, dadurch daß er den Angeber verhinderte, Dokumente, die ihn des Majestätsverbrechens überführten, vorzulegen. Daß er die Rettung des Senates gewollt habe, bejaht er freudig, da aber die Ankläger nicht S. 203 verhindert seien (Cons. 18, 57 ff.), sei diese Anklage hinfällig. Den zweiten Punkt der Anklage, daß er Briefe geschrieben habe, um die römische Freiheit wieder zu erlangen, weist er fast mit Spott zurück. „Was soll ich von den gefälschten Briefen sagen?“ Seine Angeber hätten ja selbst das Richtige ausgesprochen, „daß sich kein Rest von Freiheit mehr hoffen ließe. O, daß er sich doch ließe“ (Cons. 18,74). Der dritte Punkt, die Anklage auf Sakrileg schmerzt ihn, weil sie seinen Charakter, seine philosophische Erziehung, sein reines Leben, ja „die unschuldige Heimlichkeit“ seines Hauses besudeln möchte. Gerade in diesem letzten Punkte der Anklage verraten sich am deutlichsten Neid und Eifersucht auf die großen Erfolge in Boethius' Leben, die ja eben aller Augen auf sich zogen. Boethius sagt, man schuldige ihn an, daß er, „um Würden zu erschleichen, sein Gewissen mit einem Sakrileg befleckt habe ... unter dem Schutz verworfener Geister“ (Cons. 20,109 f. u. 115 f.). Solch eine Anklage war am leichtesten zu machen, weil am schwersten zu entkräften. Nach dem Codex Justiniani26 wurde gerade die Usurpation eines höheren Amtes als offenbare Schuld emes Sakrilegs angesehen, weil sie göttliche Vorschriften mißachte (divinus zugleich göttlich wie kaiserlich). Sehr geschickt wenden die Römlinge-Ankläger römische Rechtssätze an, nach denen der König als Reichsverweser einen Römer allein richtet.
Des Boethius Wahrhaftigkeit, selbst wenn sein Leben und sein Tod nicht jeden Zweifel daran ausschließen sollte, beweist schon der Umstand, daß er ja wissen mußte, daß alle seine Papiere nach seinem Tode gleich bekannt würden. Aber Boethius kannte die Welt, die nur zu leicht geneigt ist, dem Gefallenen wenigstens irgend eine Schuld anzuhängen. „Das ist die äußerste Bürde widrigen Schicksals: Wenn sich an die Unglücklichen irgend eine Beschuldigung heftet, so glaubt man, daß sie das, was sie dulden, auch verdient hätten“ (Cons. 22,130). Auch seine späten Kritiker von heute scheinen sich von dieser Auffassung nicht ganz befreien zu können.27
Boethius und, wie der Anonymus sagt, auch Albinus sei dann in das Gefängnis in Pavia geführt. Doch verlautet von dem Schicksal des Letzteren nichts weiter. Pavia, das alte Ticinum, das „Bollwerk der gotischen Herrschaft“, war die dritte der Residenzen des Theoderich neben Ravenna und Verona. Es liegt 423 milia passuum von Rom entfernt (Boethius sagt, wie wir gleich sehen werden, fast 500 Meilen). 400 milia im Umkreis von Rom spricht schon das alte Recht als Bannmeile für bestimmte Verbrechen von Römern aus, so ist auch der Verbannungsort des römischen Senators wohl absichtlich unter Berufung auf dieses alte Recht gewählt worden. Wie man ihn dort zuerst gehalten hat, ist nicht auszumachen, daß er aber, wie selbst Usener 28 S. 204 aus Cons. 46, 49 schließt, auch nach der Verurteilung nicht eingekerkert, sondern nur in freier Haft gehalten sei, dagegen spricht, selbst wenn man einen zum Tode Verurteilten nicht einkerkerte, die Schildermg am Eingang unseres Werkes. Die Musen werden über die Schwelle gewiesen, die Philosophie läßt sich auf das Ende des Bettes nieder, der traurige Ort wird mit seiner prächtigen Bibhothek verglichen, die Philosophie findet dort bei ihm zwar nicht Bücher, aber das, was erst ihren Wert ausmacht, den Sinn der Bücher. Die ganze Atmosphäre der Umgebung verlangt den Kerker. Über den weiteren Verlauf des Prozesses gehen aus der Darstellung des Boethius mit Sicherheit zwei Dinge hervor: Einmal, daß er zu der Gerichtsverhandlung nicht zugezogen wurde, so daß er sich selbst hätte verteidigen können, ihm auch kein Rechtsbeistand gewährt wurde, er sei „stumm und unverteidigt zu Tod und Ächtung verdammt“ (Cons. 20, 106), seine Güter wurden ihm konfisziert; ferner, daß dieses Urteil von dem Senat ausgesprochen oder zum mindesten bestätigt worden ist. Nur diesem Urteil gilt seine Klage, „jetzt werden wir, fast 500 Meilen entfernt, wegen allzu großen Eifers für den Senat ... verdammt. O über sie, die es verdienten, daß niemand eines gleichen Verbrechens überwiesen werden könnte“ (Cons. 3,106 f). Nur von Rom ist er ungefähr 500 Meilen, genau, wie erwähnt, 23 milia passuum entfernt. Gewiß, der Senat war damals machtlos genug; aber wir sahen, daß Theoderich nicht nur die römischen Rechte beschworen, sondern sie auch eingehalten hat. Der codex Theodosianus schreibt nun vor,29 daß ein Senator nur von einem Konsortium von fünf Senatoren unter dem Vorsitz des praefectus urbi abgeurteilt werden dürfte. Theoderich hat dieses Fünfmännergericht (iudicium quinquevirale) anerkannt und angewandt. Cassiodor schreibt (Var. IV, 23) an einen vornehmen Goten, er möge zwei der Magie angeklagte Senatoren vor dieses Gericht ziehen und selbst dabei den König vertreten. So wird auch im Prozeß des Boethius der König wenigstens den äußeren Schein gewahrt haben; das Gericht der fünf Senatoren hat in Rom getagt, und der König hat dazu, wie der Anonymus berichtet, den Präfekten von Ticinum Eusebius berufen und nach Rom als seinen Vertreter geschickt. Hätte das Gericht in Pavia getagt,30 wo ja Boethius in Gewahrsam gehalten wurde, ohne daß man ihn selbst zugezogen und gehört hätte, so wäre diese selbst für jene Zeit unerhörte Rechtsverletzung ganz unbegreiflich. „Hätte es geheißen, daß wir die heiligen Tempel in Brand stecken, daß wir die Priester mit dem Schwert vertilgen, allen Guten den Tod bereiten wollten, so hätte doch nur den Anwesenden, S. 205 Überführten, Bekennenden der Richterspruch bestrafen können“ (Cons. 20, 101 ff). Sehr wahrscheinlich ist, daß Eusebius schon mit dem fertigen Urteil nach Rom geschickt wurde, wie es ja Boethius auch bei der Anklage des Albinus ausspricht, „daß den Albinus nicht die Strafe für eine schon vorher verurteilte Anklage traf“ (Cons. 16,39 f). Daß dann der eingeschüchterte, feige Senat, aus Furcht, in den Prozeß nun wirklich selbst hineingezogen zu werden, sich dazu hergab, das Urteil rechtskräftig über seinen besten Mann auszusprechen, muß nach des Boethius eindeutigenWorten als sicher gelten. Daß nicht der ganze Senat so dachte, daß Boethius Freunde hatte, die alles taten um ihn zu retten, wäre auch ohne seine ausdrücklichen Worte durch des Symmachus Persönlichkeit sicher. Seiner Bemühung, vom König eine Begnadigung zu erhalten, auf die wohl auch Boethius einen Augenblick gehofft hat (Cons. 44,26 ff), ist es zu danken, daß zwischen dem Urteil und dessen Vollstreckung eine so lange Zeit verstrich, lang genug, daß er unterdes sein unsterbliches Werk schreiben konnte. Aber Symmachus, trotzdem er zu jener Zeit caput senatus war, blieb nicht nur im Senat in der Minderzahl, er hat auch beim König nichts ausrichten können. Gegen Ende des Jahres 524 wurde das Urteil an Boethius unter grausigen Folterqualen31 vollstreckt. Usener 32 glaubt wohl mit Recht, daß man von ihm durch solche Foltern belastende Anklagen gegen andere Senatsmitglieder hat erpressen wollen. Bald aber zeigte es sich, wie gefährlich es war, sich vom Senat aus zu weit vorzuwagen, auch Symmachus wurde vor Gericht gezogen und von dem verblendeten König auf Drängen der Hofpartei i. J. 525 hingerichtet. „Es war die erste und letzte Untat, deren der König sich gegen seine Untertanen schuldig machte, und diese war nur möglich, weil er ganz gegen seine Gewohnheit ohne sorgfältige Untersuchung das Urteil über jene beiden gesprochen hatte“, so schließt Procop33 seinen Bericht, nachdem er die tiefe Reue des Königs über das Unrecht, das er an den beiden Männern begangen hat, etwas novellistisch ausgeschmückt und seinen Tod in nahe Verbindung mit dieser Tat gebracht hat.
Wie zu erwarten, heimsten die Ankläger des Boethius, Cyprianus an der Spitze, hohe Ehren am Hofe ein. Er wurde noch i. J. 524 zum comes sacrarum largidonum ernannt und unter Athalarich zum Patricier gemacht. Cassiodor mußte in seinem Elogium bei dieser Gelegenheit (Var. VIII 21/22) noch besonders hervorheben, daß er nicht nur selbst der gotischen Sprache mächtig war, sondern auch seine Söhne gotisch erziehen ließ. Der Anonymus (§ 61) teilt unter den weisen Aussprüchen des Theoderich, „die noch heute von dem Volke sprichwörtlich gebraucht werden“, einen mit: „Wer ein schlechter Römer ist, möchte gerne Gote sein, und wer S. 206 ein schlechter Gote, gerne Römer.“ Ob man dabei auch an Cyprianus denken dürfte? Auch sein Bruder Opilio wurde später mit diesem Amt belehnt. Wir begegnen diesem dann noch i. J. 534 als Gesandten in Byzanz, wo er im Gegensatz zu dem wahrheitsgetreuen Bericht der übrigen Gesandten die Missetat des Theodahad gegen Amalasuntha ableugnete.34 Theoderichs Tochter und Nachfolgerin auf dem Thron, Amalasuntha, versuchte das Unrecht ihres Vaters in etwa wieder gut zu machen, indem sie die eingezogenen Güter der Gattin und den Kindern des Boethius wieder gab. Aber den Schmerz Rusticianas konnte sie damit nicht stillen. Ihrem tiefen Haß gegen die Goten war es noch vergönnt, den Untergang des Hauses des Theoderich zu erleben, aber sie mußte auch die für Rom so furchtbaren Kriege zwischen Belisar und Totilas ansehen. Ein höchst pathetisches Bild entwirft Procop35 von ihr nach der Einnahme Roms durch Totilas. Ihr ganzes großes Vermögen hatte sie geopfert, um der Not während der Belagerung etwas zu steuern. Die Goten warfen ihr nun vor, sie habe durch reiche Geschenke die römischen Heerführer dazu gebracht, die Bildsäulen des Theoderich zu zerstören, um für ihres Vaters und des Gatten Tod Rache zu nehmen, sie wollten sie daher umbringen. Totilas aber duldete es nicht, daß ihr und den andern Frauen ein Leid geschehe und schützte sie vor Tod und Schmach. Sie aber sei gänzlich verarmt mit anderen Senatsmitgliedem in Bauern- und Sklaventracht bettelnd von Tür zu Tür gegangen, um mit etwas Brot ihr Leben zu fristen. Als vor 20 Jahren die Trösterin Philosophie dem Gatten die Schätze aufzählt, die ihm noch geblieben: den Schwiegervater, den Kreis treuer Freunde, die Gattin und die Kinder lebend und in Freiheit, schloß sie mit den Worten: „Dich hat noch kein allzu starker Sturm überfallen, solange diese Anker halten, die nicht zulassen, daß dir der Trost der Gegenwart noch Hoffnung auf die Zukunft fehlen“ (Cons. 44,24 ff.). Eine gnädige Zukunft hat dies Bild tiefsten Verfalls und Untergangs seinen Augen verhüllt.
Wir Spätgeborenen mögen nun unsere Blicke auf das Werk selbst richten, das aus Kerker und Not geboren sein Licht bis in unsere Tage strahlen läßt. „Es ist etwas Großes um ein Werk, das nach 1400 Jahren den Menschen, die Zeit, den Sieg im Untergang mit so echter Überzeugungskraft vor Augen führt“ (Gothein). Es berührt die Unmittelbarkeit des Werkes nicht, nicht die Wirkung, die es noch heute auf den Leser ausübt, wenn man nachweist, daß der Gedankeninhalt aus bestimmten Werken des Altertums herstammt oder von Zeitrichtungen getragen wird. So sehr dies gelehrte Untersuchung immer reizen wird, so bleibt in jedem Falle als sein Eigenstes die Gewalt des inneren und äußeren Erlebens, das daraus zu uns spricht. Boethius nennt immer wieder und fast ausschließlich die beiden Großen, Aristoteles und S. 207 Plato als seine Lehrer, und je weiter das Werk fortschreitet, tritt Plato immer führender hervor, während, wie wir sahen, die formalen Grundlagen des Aristoteles seine gelehrte Tätigkeit fast ganz beherrscht hatten. Wollte er nun hier das ihm schon früh vorschwebende Ziel erreichen, die Harmonie der beiden Meister darzutun? Nicht in gelehrter Untersuchung, aber im begeisterten Aufschwung seiner Gedanken hat er es vielleicht erreicht. Im Kerker, seiner Bücher beraubt, aber in treuem Gedächtnis alles tragend, „was den Büchern Wert verleiht, den Sinn der Bücher“, tröstet er sich selbst in der Betrachtung jener Fragen, die ihn sein ganzes Leben beschäftigt haben. Dort trifft ihn zuerst, den vom Schmerz verdunkelten, nur von den weltlichen Musen umgeben die hohe Frau, die sein von Tränen überströmendes Auge anfangs nicht erkennen kann, seine Ärztin, Trösterin und Führerin, die Philosophie. Gleich die Schilderung ihres Äußeren, besonders ihres Gewandes, gibt das Leitmotiv des ganzen Werkes an. Im unteren Saum ihres Kleides, das sie selbst gewebt hat, ist der griechische Buchstabe π eingezeichnet, am obersten Rande aber liest man ein θ; zwischen beiden führen Sprossen einer Leiter von dem unteren zum oberen empor. Der untere steht für πρακτική, der obere für θεωρητική, was Boethius selber an anderer Stelle nach der herkömmlichen Einteilung mit philosophia activa und speculativa übersetzt.36 So steigt auch die ganze Unterredung wie auf einer Leiter von dem aktiven wirren Leben auf zu den reinen Höhen der Spekulation.
In Dialogform nach platonischem Muster, wobei die Philosophie die Führung des Gespräches übernimmt, sind die Prosateile abgefaßt. Zwischen jedes Kapitel ist ein Gedicht eingeschaltet. Diese Mischform war damals unter dem Namen Satura Menippea bekannt und nicht selten angewandt, aber meist nur — wie auch von Varro und Martianus Capella —, um ethische Fragen populär und satirisch zu behandeln. Die 38 Gedichte sind durchaus nicht gleichmäßig oder auch gleichwertig; schon die Metra sind außerordentlich abwechslungsreich, nur wenige kehren öfters wieder. Inhaltlich bewegen sie sich von kurzen Sprüchen, die manchmal wie ein Atemholen nach schwieriger philosophischer Untersuchung anmuten, manchmal auch nur kurz ihren Inhalt zusammenfassen, bis zu den hinreißend großen Hymnen, wie sie in der nachklassischen lateinischen Sprache wohl ihresgleichen nicht haben.
Die ersten Kapitel zeigen uns den Dichter tief in das Wirrsal des Schmerzes versenkt. Als Ärztin tritt die Philosophie zu dem seelisch schwer Erkrankten, mit ärztlicher Würde schilt sie die verweichlichenden Musen von seinem Lager und läßt sich, als er sie erkennt, auf das Ende desselben nieder; ärztlich sind ihre Bilder und als Arzt verlangt sie, daß er ihr den Grund S. 208 seiner Klagen offenbaren möge. Das gibt Boethius Gelegenheit, sein Leben, seinen Sturz, den Grund seines Hierseins an diesem Orte öder Verbannung zu berichten. Noch herrschen hier Zorn und Abscheu über das Böse und das bittere Unrecht, das man ihm getan, vor, wir werden mitten hineingeführt in das wogende Leben der Zeit. Aber die Ärztin kann doch zum Schluß des ersten Buches schon die Diagnose der Krankheit feststellen: Weil du von Vergessenheit deiner selbst verwirrt bist, fühlst du dich schmerzlich verbannt und deiner Güter beraubt. Weil du nicht weißt, was der Endzweck der Dinge ist, hältst du nichtswürdige Schurken für mächtig und glücklich. Weil du vergessen hast, mit welchen Mitteln die Welt regiert wird, urteilst du, daß diese Wechselfälle des Glücks ohne Lenker umherwogen. — Doch noch muß der Kranke mit milderen Mitteln behandelt werden. Daß die Glücksgöttin sich ihm so falsch erwiesen, darin sieht er selbst den Grund für seinen Kummer. Das ganze zweite Buch untersucht daher das Wesen der Fortuna. In den beiden ersten Kapiteln wird ihr Charakter, der Unbeständigkeit an sich ist, aufgezeigt, im zweiten wird sie selbst redend und sich verteidigend eingeführt: „Streite doch vor jedem beliebigen Richter mit mir über den Besitz der Schätze und Würden; und wenn du zeigen kannst, daß irgend etwas davon Eigentum irgend eines Menschen sei, so will ich gerne zugeben, daß das, was du zurückforderst, dein gewesen ist.“ Aber noch ist das Gemüt des Kranken nicht beruhigt; als im dritten Kapitel ihm die Philosophie die Glücksgüter, die ihm das Leben überreich gespendet hatte, aufzählt, antwortet er: „Das gerade quält in der Erinnerung noch heftiger, denn bei jeder Widerwärtigkeit des Geschicks ist das die unseligste Art des Unglücks, glücklich gewesen zu sein.“ Mit fast den gleichen Worten läßt Dante Francesca von Rimini ihren Schmerz im Inferno ausdrücken. Die Ärztin aber führt ihn nun einen Schritt weiter, sie zählt ihm die Schätze auf, die er noch besitzt. Diese Betrachtung beruhigt ihn nun so weit, daß von der persönlichen Not der Blick auf den Wert der Glücksgüter überhaupt gerichtet werden kann. In der zweiten Hälfte dieses streng parallel aufgebauten Buches 37 werden nun die einzelnen von den Menschen als Glücksgüter angesehenen Gaben, als Reichtum, Würden, Ruhm, Vergnügen aufgezählt und ihre Nichtigkeit in oft prächtigen Bildern mit folgerichtigen Vernunftgründen bewiesen.
Somit werden, nachdem das Persönliche abgetan ist, die ersten Stufen der Leiter langsam erklommen. Und als dieses Buch mit dem herrlichen Hymnus auf die göttliche Liebe, die das Weltall regiert, schließt, da verlangt der Genesende, „von der Macht der Gedanken und der Holdseligkeit des Gesanges erquickt“, nun selbst nach den anfangs versprochenen kräftigeren Heilmitteln. So beginnt das dritte Buch damit, daß die Philosophie ihm wenigstens von weitem das wahre S. 209 Glück, von dem sein Geist träumt, zeigen kann. Alle Menschen, belehrt sie ihn, streben nach Glück, aber die meisten suchen es auf falschem Wege, da der Irrtum sie verblendet; alle einzelnen Glücksziele haben wohl etwas Erstrebenswertes in sich, aber vereinzelt kehren sie sich zum Mangel und können daher nicht nur nicht Glück bringen, sondern werden zum Verderben der Irrenden. Wieder wird das an den einzelnen Glücksgütern im größten Teil des dritten Buches bewiesen. Aber mit dem elften Metrum wird die Seele in dem wunderbaren Gebet wie mit plötzlichem Aufschwung in die Höhe gerissen. Nach dem Vorbild des Platon im Timäus, sagt die Philosophie, wollen wir den Vater des All anrufen, damit er uns Kraft für den kommenden Aufstieg gibt. So gewiß die Gedanken dieses Gebetes von dem kosmischen Mythos des Timäus befruchtet sind, so schwingt doch ein Neues durch diese Rhythmen; scheinen sie auch weltfern von jedem christlichen Dogma, so fühlt man doch in der Innigkeit der beseelten Sprache die Nähe christlicher Hymnen. Damit ist der Blick von dem Geschaffenen zum Schöpfer, vom Irdischen zum Himmlischen empor gelenkt. Er, der Schöpfer, trägt das Glück, das alle Menschen erstreben, als Ganzes in der Einheit seines Wesens. Nach Einheit strebt die ganze Natur, Gott aber ist Einheit und Glückseligkeit, so strebt alles zu Gott. „Er also ist das höchste Gut, der alles kraftvoll regiert und sanft ordnet.“ Das Schlechte ist nichts, da Gott nichts Schlechtes tun kann. Hiermit aber wird ein neues Problem aufgerollt, das Boethius in neue Verwirrung stürzt. Auf die bange Frage: wie kann Gott, der das Höchste Gute ist, das Schlechte dulden, dulden, daß die Schlechten mächtig sind und die Guten unterdrücken? antwortet die Philosophie: „Die Guten sind immer stark und mächtig, die Bösen aber schwach und machtlos.“ Daß alle nach der Glückseligkeit streben, war zugegeben. „Die Guten aber streben danach und erreichen ihr Ziel auf naturgemäßem Wege, die Schlechten aber irren auf naturwidrigem Wege.“ „Es ist eine fast unvermischt platonische Ethik, wie sie im Gorgias entwickelt wird, die in diesem Buch vorgetragen wird, mit einigen feinen christlichen Retouchen und an Feinheit und Lebendigkeit des Dialogs auch echt platonisch. Dieser siegesgewisse Idealismus, der den eignen Tod und den Untergang der ganzen Kultur vor Augen sich so zuverlässig tröstet, daß allein das Gute Macht besitze und das Schlechte die Strafe in sich trage, hat etwas Grandioses“ (Gothein). Wie viel aber, was Boethius gerade hier von Platon empfangen und doch in seiner Weise eigen gestaltet und neu geschaffen hat, durfte er wieder in die Jahrhunderte weiter geben. Der großartige Gedanke: die Schlechten sind nicht nur nicht mächtig, sie sind überhaupt nicht, sie tragen zwar menschlichen Körper, aber eine Tierseele wohnt in ihnen, durfte wieder in Dante zünden, als er im Inferno die Seelen der Verdammten sieht, die noch auf Erden in menschlichem Körper wandeln. Plato läßt S. 210 Sokrates im Gorgias mit seiner Lehre nur den Übermut unfrommer Menschen dämpfen, die da meinen, daß die Bösen, weil sie mächtig scheinen, auch glücklich seien, Boethius aber sieht die Lösung in der Blödigkeit des Menschenauges überhaupt, das die wahre Ordnung der Dinge nicht erkenne. So werden wir im zweiten Teil des dritten Buches zu der großen Untersuchung über Schicksal und Vorsehung geführt. Auch dieses ist eine Frage, die die Zeit auf das tiefste bewegte, besonders die Neuplatoniker Plotin und Proclus hatten sie immer wieder zu lösen versucht. Boethius klare, scharf geschliffene Sprache aber hebt das Problem fast bis in moderne Gedanken hinein: Vorsehung und Schicksal, zwei Namen, die dasselbe von zwei verschiedenen Seiten aus betrachten. Was die Vorsehung dem ewig unbewegten Göttlichen zugewandt, das ist das Schicksal für das immer bewegte Irdische, es ist die Wirkung der Vorsehung in das Irdische hinein. Seltsam mutet das siebente letzte Kapitel des vierten Buches an, es scheint ein Rückblick auf schon Erreichtes; der Schluß aber verrät die Absicht, es ist noch einmal das Aufflackern römischer „Virtus“, der Manneskraft, die alte herrscherliche Haltung: Nicht dem Müßigen, Verzagten wird das Schicksal sich neigen, „ein jedes Schicksal, das rau scheint, straft, wenn es nicht übt oder bessert“, und an die Mühsalen und Arbeiten der Heroen, besonders des Herkules anknüpfend, schließt es: „Nur dem Erdbesieger winken die Sterne.“ — Aus der Wesensbestimmung der Vorsehung wächst nun das letzte Buch heraus, „das mit seinem ungestümen Drang und hohen Flug das Problem behandelt, das jener Generation von Augustus bis Boethius auf dem Herzen lag: die Willensfreiheit“ (Gothein). Noch einmal drängt sich ein heftiger, wohl der schwerste Zweifel auf: Wie ist Willensfreiheit mit Vorsehung zu vereinigen? Ein ganzes Kapitel (V. 3) braucht Boethius um seine Einwände auseinander zu setzen. Aber auch hier ist die Antwort: Menschliche Kurzsichtigkeit reicht nicht an die ewige Klarsicht der Vorsehung heran. Die Untersuchungen des vierten Kapitels muten uns fast wie eine Vorausnahme Kantischer Gedanken an, nicht in den Dingen liegt die Fähigkeit sie zu erkennen, sondern in den Fähigkeiten des Erkennenden. Anders erkennen die Sinne, anders die Einbildungskraft, anders die Vernunft, anders die göttliche Intelligenz. Diese vierfachen Erkenntnisvermögen steigen so auf, daß die höhere die niedere umgreift, die niedere aber die höhere nicht fassen kann. Den Menschen sind drei dieser Fähigkeiten zu eigen, die göttliche Intelligenz aber kann der Mensch nur ahnend schauen. Und so nahen wir uns der höchsten Stufe, die die Führerin Philosophie ihren Schüler ersteigen läßt, ihrem höchsten Trost. Das Schlußkapitel, das Zeit und Ewigkeit in ihrem Wesen zu enthüllen versucht, hat als das berühmteste die größten Geister des Mittelalters zur Bewunderung fortgerissen und angefeuert. „Alles was in der Zeit lebt, geht als ein Gegenwärtiges S. 211 von der Vergangenheit zur Zukunft, das Morgige erfaßt es noch nicht, das Gestrige hat es schon verloren, und auch im heutigen Leben lebt ihr nicht weiter als in diesem beweglichen, vorübergehenden Augenblick ... Was aber die ganze Fülle des unbegrenzten Lebens gleichmäßig erfaßt und besitzt, wem weder etwas an dem Zukünftigen abgeht, noch im Vergangenen verflossen ist, das wird mit Recht als ewig angesehen.“ Hierbei wird auch das Problem der anfang- und endlosen Welt, die Aristoteles und Plato wenn auch in verschiedener Weise behaupten, behandelt. Boethius will sie nicht ewig im göttlichen Sinne nennen; denn wenn sie auch im Fluß der Zeit unbegrenzbar ist, so fehlt ihr doch die noch nicht durchlebte Zukunft; so will er der Welt nur 'Dauer' zubilligen. Gott aber ist ewig, denn in seiner Einfachheit erschaut er mit einem Blick das Vergangene und Zukünftige als seine Gegenwart. Hierin werden nun auch die letzten Zweifel des freien Willens gelöst: Der Handelnde ist frei zu wollen oder nicht zu wollen in der Zeit, vor der göttlichen Ewigkeit aber ist alles notwendig so wie es geschieht; „denn Gott in seiner einfachen Gegenwart erschaut ja nicht nur deine zukünftige Tat, sondern auch deinen freien Willen es zu tun.“ Darum mußt du mit freiem Willen das Laster meiden, die Tugend üben und dich im Gebet zum Höchsten erheben. „So ist euch eine große Notwendigkeit der Redlichkeit auferlegt, denn ihr handelt unter den Augen eures alldurchschauenden Richters.“ So schließt das Werk! Nahm ihm ein grausamer Tod den Griffel aus der Hand? Hatte er noch mehr zu sagen? Kaum, denn die höchste Staffel war erstiegen.
Nur einmal noch hatte eine ähnlich erschütternde Stunde für die Weltliteratur geschlagen, als der große Lehrer des Boethius, Plato, es unternahm, im Phaidon im Tod des Sokrates „seinen Sieg“ zu schildern. Hätte aber Boethius mit göttlichem Auge die Zukunft als Gegenwart schauen können, so hätte er Jahrhunderte später eine Stunde sehen können, in der der größte Dichter aus seinem nachlebenden Volke, in der Dante, selbst in trostlosen Schmerz versenkt durch den Tod „des Entzückens meiner Seele“, dies Büchlein in die Hand bekam, „um mich zurückzuwenden zu dem Wege, welchen ein anderer Trostloser eingeschlagen hatte. Und wie es nun geschieht, daß jemand Silber sucht und Gold findet, welches ihm eine verborgene Ursache nicht ohne göttliches Walten darbietet, so fand ich, der ich mich zu trösten suchte, nicht nur ein Heilmittel für meine Tränen, sondern Worte von Autoren, Wissenschaft und Büchern, bei deren Betrachtung ich wohl urteilen mußte, daß die Philosophie als ihre Herrin ein sehr hohes Ding sein mußte. Und ich dachte sie gestaltet als eine edle Frau, ich konnte sie in keinem anderen Verhalten als dem der Barmherzigkeit sehen, und mein Sinn für Wahrheit schaute sie S. 212 so an, daß ich meinen Blick kaum von ihr wenden konnte“.38 Damals hat sich diese „gentilissima Donna“ mit dem Bilde Beatricens trostreich im Göttlichen Gedichte verbunden.
Wieviele Trostbedürftige sich an dem Troste der Philosophie aufgerichtet, davon erzählen die zahlreichen Übersetzungen in alle Sprachen, mit deren Häufigkeit sich nur einige biblische Bücher messen können; auch von Handschriften werden noch heute über 400 gezählt, die vom zehnten Jahrhundert an auf uns gekommen sind. Sie sind ein äußeres Zeichen von der Bedeutung unseres Werkes für das Mittelalter. Wie es seine Gedankenwelt beeinflußt, ihr Richtung gegeben, sie gestaltet hat, kann auf kurzem Raum nicht einmal andeutungsweise berührt werden, so verlockend eine solche Aufgabe auch sein müßte.
So möge diese Ausgabe und die Übersetzung, wie sie dem Übersetzer selbst sein ganzes Leben hindurch ein Leitstern gewesen, sich auch für unsere Zeit Freunde und neue Wirksamkeit erobern.
-
Parad. XI 24. ↩
-
Hermann Usener, Anecdoton Holderi, Ein Beitrag zur Geschichte Roms in ostgotischer Zeit, p. 4 (Festschr. z. Begr. der 31. Versamml. deutscher Phil. in Wiesbaden). ↩
-
Cassiodor, Variae ed. Mommsen MGH I 23; IV 51. ↩
-
Avitus Ep. 34. ↩
-
M. F. Ennodii Opera, corp. scr. eccl. p. 181 Ep. VII, 13. Rhetorica p. 409. ↩
-
Comment. zu Aristot., De interpret. ed. sec. P.L. 64, 433 C.D. ↩
-
Mommsen, Ges. Schriften VI p. 422. ↩
-
S. über die Datierung Usener, Anecdoton Holderi p. 39/40. ↩
-
L. Schrade, Das propädeutische Ethos in der Musikanschauung des Mittelalters. Zeitschrift f. Geschichte d. Erziehung und d. Unterr. 1930 ↩
-
Boethius ed. H. F. Steward and E. K. Rand, p. X (The Loeb Classic. Library). ↩
-
Vgl. dazu aber Brandt, Entstehungsz. u. zeitliche Folge der Werke des Boethius, Philol. 62, 1903 , P. 238, der ihn erst 512 ansetzen möchte. ↩
-
Comment. in Aristotelis De Interpret. ed. sec. P.L. 64,433 D. ↩
-
Usener, Anecdoton Holderi p. 50. ↩
-
Comment. in Aristotelis Categorias II P.L. 64 col. 201 B. ↩
-
Anecdot. Holderi S. 18. ↩
-
Th. Mommsen, Ostgotische Studien. Gesammelte Schriften Bd. VI S. 382. Rechtlich steht dem Kaiser allein das Recht der Ernennung zu, aber Mommsen weist auf die häufigen Fälle hin, wo Theoderich selbständig Consuln ernannt hat. ↩
-
Teuffel-Kroll, Geschichte der röm. Literatur III 475 und wohl nach ihm J. Sundwall, Abh. zur Geschichte des ausgehenden Römertums, p. 204 A.4 , beide ohne Quellenangabe. ↩
-
Mommsen, Ges. Schriften VI p. 383. ↩
-
Usener, Anecd. Holderi p. 23. ↩
-
Procop, Bell. Goth. I, 1. ↩
-
Mommsen, Ges. Schriften VI S. 384. ↩
-
Pfeilschifter, Der Ostgotenkaiser Theoderich d. Gr. und die kath. Kirche. Kirchengesch. Studien III p. 163. ↩
-
Anonymus Valesianus 14 § 88. ↩
-
Anon. Vales. 14 § 85. ↩
-
Usener, Anecd. Hold. p. 18. ↩
-
Cod. Just. 12,8,1. ↩
-
) Hodgkin, Italy and her Invadors 1896 III p. 489 ff. Sundwall, Abbandl. zur Gesch. des ausgehenden Römertums 1919, S. 241 A. 3; 243 u. A. 4; 244 u. A. 1. ↩
-
Anecd. Holderi p. 78. ↩
-
Th. Mommsen, Römisches Strafrecht p. 287/288. ↩
-
Die Stelle bei Anon. Vales. S 87 heißt rex vero vocavit Eusebium praefectum urbisTicini et inaudito Boetio protulit in eum sententiam. R. Cessi, der neueste Herausgeber des An. Val. (Rer. Ital. scr. nuova serie 24, 4 p. 20,5-10), will dafür lesen vocavit Eusebium, praefectum urbis, Ticinum, d. h. der König habe den Präfekten der Stadt Rom nach Ticinum berufen. Dazu Introd. p. CL. Vergl. auch Sundwall a. a. O. p. 248. ↩
-
Über Anwendung von Folterqualen s. Mommsen, Strafrecht, 406 u. 407 Anm. 4. ↩
-
Anecd. Hold. p. 78. ↩
-
De Bell. Goth. I,1. ↩
-
Procop, De bello Gothico I,4. ↩
-
De bello Goth. III,20. ↩
-
Porphyrius, Isagoge a Victorinuo transl. I, 4 (Brandt, Corp. scr. eccl. lat. 48 p. 10). ↩
-
Darüber F. Klingner, De Boethii Consolatione Philosophiae, Phil. Unters. Heft 27 p. 22 ff. ↩
-
Dante, Convivo II c. 13. ↩