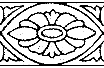1. Kapitel. Was Augustinus vom Leser und von sich selbst verlangt. In Gott gibt es keine Veränderung und keine Materie.
S. 187 1. Ich beginne nun jene Wirklichkeit darzustellen, die von keinem Menschen, bestimmt nicht von uns ganz so dargestellt werden kann, wie wir sie denken — freilich weiß sich auch schon unser Denken, wenn wir über Gott die Dreieinigkeit nachsinnen, dem Gegenstande ganz und gar nicht gewachsen; es vermag ihn nicht zu erfassen, wie er ist, sondern vielmehr vermögen auch solche Köpfe, wie der Apostel Paulus auf diesem Gebiete einer ist, ihn nur „ im Spiegel und in Rätseln“1 zu schauen. Deshalb will ich zunächst den Herrn unseren Gott selbst, an den wir immer denken sollen, über den wir nie würdig denken können, dem immerfort Lob und S. 188 Preis zu entrichten ist,2 und den auszusprechen keine Sprache genügt, um Hilfe bitten für das Verständnis und die Erklärung meines Themas und um Verzeihung für meine Mängel. Ich bin nämlich eingedenk nicht nur meines guten Willens, sondern auch meiner Ohnmacht. Ich bitte auch meine Leser um Nachsicht, wenn sie merken, daß mein Wollen größer war als mein Können, sei es, daß sie selbst die Sache besser verstehen oder daß ihnen die Schwierigkeit meiner Darstellung das Verständnis versperrt. Auf der anderen Seite werde ich es ihnen nachsehen, wenn sie wegen ihrer geistigen Schwerfälligkeit nichts verstehen können.
2. Leichter aber wird uns diese gegenseitige Nachsicht fallen, wenn wir beachten oder in unerschütterlichem Glauben festhalten, daß die Aussagen über die unwandelbare, unsichtbare, höchst lebendige, sich selbst genügende Natur nicht nach unseren gewohnten Anschauungen von den sichtbaren, wandelbaren, sterblichen und mangelhaften Dingen gemessen werden dürfen. Nun haben wir zwar schon unsere Not und fühlen wir unser Unvermögen, wenn wir die Dinge, die unseren körperlichen Sinnen naheliegen oder die Wirklichkeit unseres inneren Menschen ausmachen, wissenschaftlich begreifen wollen. Trotzdem ist es jedoch keine Ehrfurchtslosigkeit, wenn wir uns von der gläubigen Frömmigkeit für die über uns liegende göttliche, unaussprechliche Wirklichkeit entflammen lassen; diese Frömmigkeit wird ja nicht aufgeblasen von stolzem Pochen auf die eigene Kraft, sondern entzündet von der Gnade des Schöpfers und Erlösers selbst. Mit welcher Kraft der Vernunft sollte der Mensch denn auch Gott fassen, solange er seine eigene Vernunft, mit der er ihn fassen will, noch nicht faßt? Faßt er sie aber einmal, dann soll er sorgsam beachten, daß in seiner Natur nichts besser ist als seine Vernunft, und zusehen, ob er dort Umrisse von Gestalten, Glanz von Farben, räumliche S. 189 Größe, Nebeneinander von Teilen, Ausdehnung von Masse, örtliche Bewegungen oder Ähnliches sehe. Nichts von all dem finden wir fürwahr in jener Wirklichkeit, in der wir den besten Teil unserer Natur finden, das heißt in unserer Vernunft, mit der wir die Weisheit fassen, soweit wir Fassungskraft haben. Was wir nun in dem besten Teil von uns nicht finden, dürfen wir in jener Wirklichkeit nicht suchen, die viel besser ist als der beste Teil von uns. So müssen wir uns, wenn wir es vermögen und so gut wir es vermögen, Gott denken als ohne Eigenschaft gut, als groß ohne Größe, als Schöpfer ohne Bedürftigkeit, als ohne Sitz vorsitzend, als alles zusammenhaltend ohne äußere Gestalt, als überall seiend ohne örtliche Bestimmtheit, als immer dauernd ohne Zeit, als Schöpfer der wandelbaren Dinge ohne Wandlung seiner selbst, als ein Wesen ohne Leiden. Wer so von Gott denkt, kann er auch sein Wesen noch nicht völlig ergründen, bewahrt sich doch in frommer Gesinnung vor der Gefahr, soweit er dazu überhaupt imstande ist, von Gott etwas anzunehmen, was er nicht ist.